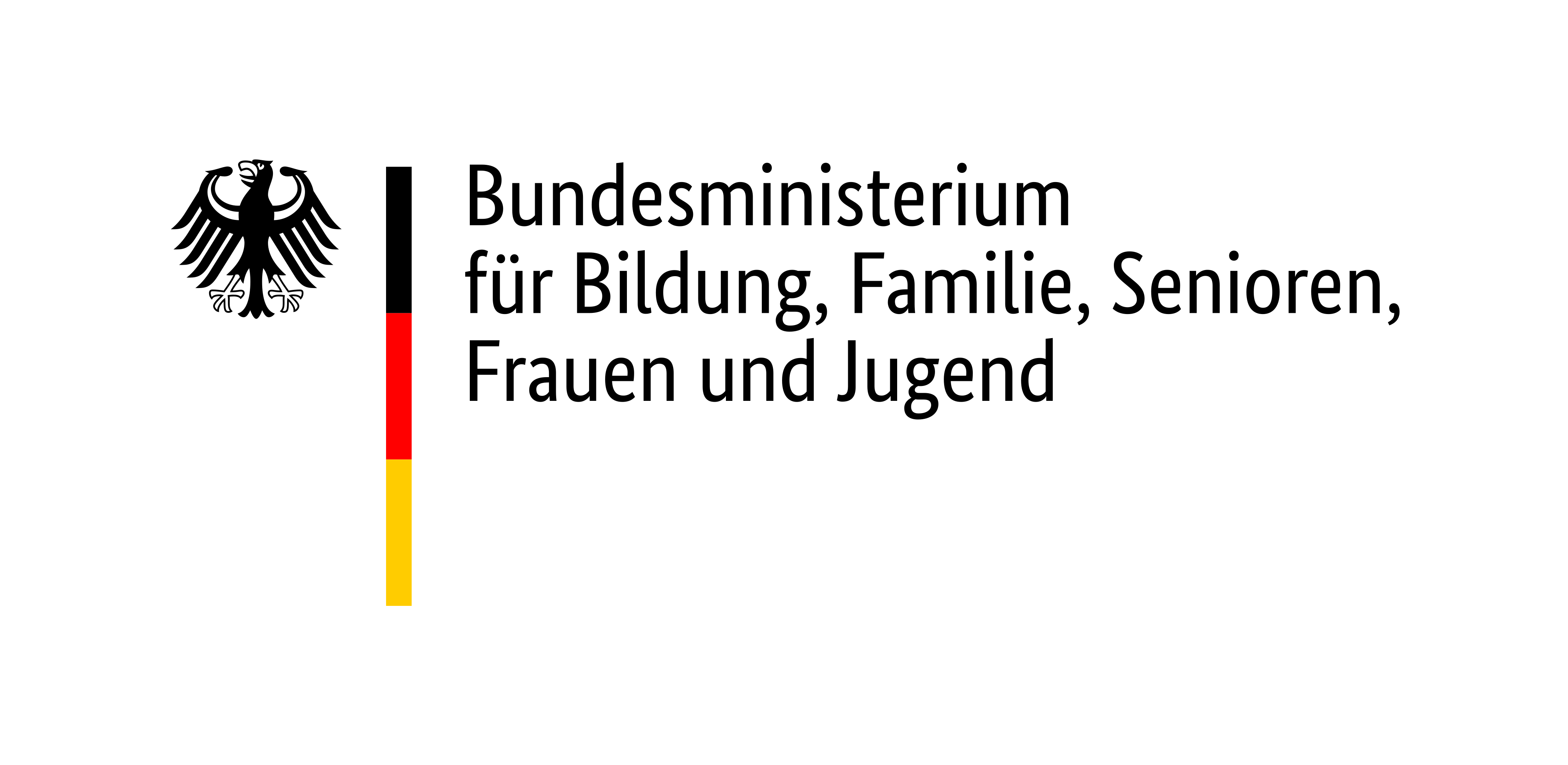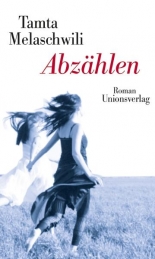
Abzählen
Tamta Melaschwili (Text),
Natia Mikeladse-Bachsoliani (Übersetzung)
Unionsverlag
ISBN: 978-3-293-00439-9
16,95 € (D)
Originalsprache: Georgisch
Preisträger 2013, Kategorie: Jugendbuch
Ab 16 Jahren

Jurybegründung
Abzählen ist ein Roman über den Krieg, in dem kein einziger Schuss fällt, und doch offenbaren sich die Schrecken in schmerzhafter Deutlichkeit, denn es geht um die so genannte Zivilbevölkerung, also die Kinder, Frauen und die Alten. Obwohl der russisch-georgische Krieg erkennbar den Erfahrungshintergrund bildet, bleibt die erzählte Welt in geografischer und historischer Hinsicht unbestimmt. In einem atemlosen, bisweilen geradezu stakkatohaften Rhythmus schildert der Roman...
drei Tage im Leben zweier 13-jähriger Mädchen, und lässt sie als Erzählstimmen zu Wort kommen.
Die Aufregungen der Pubertät und die Schrecken des Krieges liegen in diesem Text nah beieinander. Während Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, flirten die Mädchen mit Wachposten und probieren die ersten Zigaretten. Materielle Not treibt die Freundinnen zu immer gefährlicheren Abenteuern, bis sie irgendwann Drogen in Pilzkörben schmuggeln.
Der Roman wird im Präsens erzählt und vorwiegend in wörtlicher Rede, ohne Anführungszeichen und durch extrem verknappte Inquitformeln eingeleitet („sagt Ninzo:“; „sage ich:“). Dass die eigentliche Erzählinstanz, das „Ich“ des Textes, den Erzählzeitraum nicht überlebt hat, erfährt der Leser erst am Ende.
Vom Ende der Erzählung her wird auch die zeitliche Abfolge des Geschehens verständlich. Es ist eine Geschichte, die auf ein schreckliches Ereignis hin erzählt wird. Die Kapitel bilden kein zeitliches Kontinuum, sie sind eher wie Motivketten strukturiert, lassen Szenen Gestalt annehmen, so wie sie in der Erinnerung oder einem Traum aufblitzen könnten, isoliert und erst nachträglich in eine zeitliche Ordnung gebracht.
Diese Erzählweise ist weit davon entfernt, den Leser oder die Leserin emotional zu überrumpeln. Vielmehr ermöglicht sie Teilhabe an der Rekonstruktion von Vorkommnissen, die konventionelle Sprache und konventionelles Erzählen gar nicht abbilden könnten. Sie entwirft ein Gegenmodell zum allabendlichen Abstumpfungsritual der Fernsehberichterstattung.
Ein Romandebüt von großer emotionaler Wucht und verstörender Authentizität, dem man, obwohl es nicht ausdrücklich an junge Leser adressiert ist, eine intensive Rezeption im jugendliterarischen Kontext wünschen möchte.
Die Aufregungen der Pubertät und die Schrecken des Krieges liegen in diesem Text nah beieinander. Während Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, flirten die Mädchen mit Wachposten und probieren die ersten Zigaretten. Materielle Not treibt die Freundinnen zu immer gefährlicheren Abenteuern, bis sie irgendwann Drogen in Pilzkörben schmuggeln.
Der Roman wird im Präsens erzählt und vorwiegend in wörtlicher Rede, ohne Anführungszeichen und durch extrem verknappte Inquitformeln eingeleitet („sagt Ninzo:“; „sage ich:“). Dass die eigentliche Erzählinstanz, das „Ich“ des Textes, den Erzählzeitraum nicht überlebt hat, erfährt der Leser erst am Ende.
Vom Ende der Erzählung her wird auch die zeitliche Abfolge des Geschehens verständlich. Es ist eine Geschichte, die auf ein schreckliches Ereignis hin erzählt wird. Die Kapitel bilden kein zeitliches Kontinuum, sie sind eher wie Motivketten strukturiert, lassen Szenen Gestalt annehmen, so wie sie in der Erinnerung oder einem Traum aufblitzen könnten, isoliert und erst nachträglich in eine zeitliche Ordnung gebracht.
Diese Erzählweise ist weit davon entfernt, den Leser oder die Leserin emotional zu überrumpeln. Vielmehr ermöglicht sie Teilhabe an der Rekonstruktion von Vorkommnissen, die konventionelle Sprache und konventionelles Erzählen gar nicht abbilden könnten. Sie entwirft ein Gegenmodell zum allabendlichen Abstumpfungsritual der Fernsehberichterstattung.
Ein Romandebüt von großer emotionaler Wucht und verstörender Authentizität, dem man, obwohl es nicht ausdrücklich an junge Leser adressiert ist, eine intensive Rezeption im jugendliterarischen Kontext wünschen möchte.
Abzählen ist ein Roman über den Krieg, in dem kein einziger Schuss fällt, und doch offenbaren sich die Schrecken in schmerzhafter Deutlichkeit, denn es geht um die so genannte Zivilbevölkerung, also die Kinder, Frauen und die Alten. Obwohl der russisch-georgische Krieg erkennbar den Erfahrungshintergrund bildet, bleibt die erzählte Welt in geografischer und historischer Hinsicht unbestimmt. In einem atemlosen, bisweilen geradezu stakkatohaften Rhythmus schildert der Roman drei Tage im Leben zweier 13-jähriger Mädchen, und lässt sie als Erzählstimmen zu Wort kommen.
Die Aufregungen der Pubertät und die Schrecken des Krieges liegen in diesem Text nah beieinander. Während Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, flirten die Mädchen mit Wachposten und probieren die ersten Zigaretten. Materielle Not treibt die Freundinnen zu immer gefährlicheren Abenteuern, bis sie irgendwann Drogen in Pilzkörben schmuggeln.
Der Roman wird im Präsens erzählt und vorwiegend in wörtlicher Rede, ohne Anführungszeichen und durch extrem verknappte Inquitformeln eingeleitet („sagt Ninzo:“; „sage ich:“). Dass die eigentliche Erzählinstanz, das „Ich“ des Textes, den Erzählzeitraum nicht überlebt hat, erfährt der Leser erst am Ende.
Vom Ende der Erzählung her wird auch die zeitliche Abfolge des Geschehens verständlich. Es ist eine Geschichte, die auf ein schreckliches Ereignis hin erzählt wird. Die Kapitel bilden kein zeitliches Kontinuum, sie sind eher wie Motivketten strukturiert, lassen Szenen Gestalt annehmen, so wie sie in der Erinnerung oder einem Traum aufblitzen könnten, isoliert und erst nachträglich in eine zeitliche Ordnung gebracht.
Diese Erzählweise ist weit davon entfernt, den Leser oder die Leserin emotional zu überrumpeln. Vielmehr ermöglicht sie Teilhabe an der Rekonstruktion von Vorkommnissen, die konventionelle Sprache und konventionelles Erzählen gar nicht abbilden könnten. Sie entwirft ein Gegenmodell zum allabendlichen Abstumpfungsritual der Fernsehberichterstattung.
Ein Romandebüt von großer emotionaler Wucht und verstörender Authentizität, dem man, obwohl es nicht ausdrücklich an junge Leser adressiert ist, eine intensive Rezeption im jugendliterarischen Kontext wünschen möchte.
Die Aufregungen der Pubertät und die Schrecken des Krieges liegen in diesem Text nah beieinander. Während Mütter um ihre gefallenen Söhne trauern, flirten die Mädchen mit Wachposten und probieren die ersten Zigaretten. Materielle Not treibt die Freundinnen zu immer gefährlicheren Abenteuern, bis sie irgendwann Drogen in Pilzkörben schmuggeln.
Der Roman wird im Präsens erzählt und vorwiegend in wörtlicher Rede, ohne Anführungszeichen und durch extrem verknappte Inquitformeln eingeleitet („sagt Ninzo:“; „sage ich:“). Dass die eigentliche Erzählinstanz, das „Ich“ des Textes, den Erzählzeitraum nicht überlebt hat, erfährt der Leser erst am Ende.
Vom Ende der Erzählung her wird auch die zeitliche Abfolge des Geschehens verständlich. Es ist eine Geschichte, die auf ein schreckliches Ereignis hin erzählt wird. Die Kapitel bilden kein zeitliches Kontinuum, sie sind eher wie Motivketten strukturiert, lassen Szenen Gestalt annehmen, so wie sie in der Erinnerung oder einem Traum aufblitzen könnten, isoliert und erst nachträglich in eine zeitliche Ordnung gebracht.
Diese Erzählweise ist weit davon entfernt, den Leser oder die Leserin emotional zu überrumpeln. Vielmehr ermöglicht sie Teilhabe an der Rekonstruktion von Vorkommnissen, die konventionelle Sprache und konventionelles Erzählen gar nicht abbilden könnten. Sie entwirft ein Gegenmodell zum allabendlichen Abstumpfungsritual der Fernsehberichterstattung.
Ein Romandebüt von großer emotionaler Wucht und verstörender Authentizität, dem man, obwohl es nicht ausdrücklich an junge Leser adressiert ist, eine intensive Rezeption im jugendliterarischen Kontext wünschen möchte.
MEHR
Personen

© Foto: Unionsverlag
Text
1979 geboren, wuchs in Georgien auf. Sie verbrachte ein Jahr als Migrantin in Deutschland, wo sie zu schreiben begann. Melaschwili schloss 2008 ihr Studium der Gender Studies an der Central European University in Budapest/Ungarn ab. Gegenwärtig lebt sie in Georgien und arbeitet über Frauenrechte und Genderfragen.

© Foto: Unionsverlag
Übersetzung
1966 in Meißen geboren, studierte Germanistik und Literaturwissenschaft in Leipzig. Heute arbeitet sie im Bereich Kulturprogramme am Goethe-Institut von Tiflis/Georgien und ist freie Übersetzerin.